verspielen
Michael Hofstetter: sans et avec gaz, 2012
Kay Winkler: Im Grunde grundlos, 2012
Kunstpavillon München, 2012
Dorothée Bauerle-Willert + Shiva Lachen
Erspielen – Verspielen
Es gehört zur Tragik oder vielleicht auch zur Herausforderung unserer Zeitgenossenschaft, dass uns nichts mehr selbstverständlich gegeben ist. Auch der Raum nicht, in dem wir leben. Für den modernen Menschen wurden die Räume zu Hüllen, deren Ortstauglichkeit spätestens ab dann immer wieder aufs Neue hergestellt werden muss.
Es war Martin Heidegger, der 1927 in seinem Buch „Sein und Zeit“ den Raum als den, immer schon mitgegebenen, Umraum unseres Daseins beschrieb. Raum und Dasein gehören für ihn konstitutiv zusammen und nur die technologische „Fernung“ des Raumes von unserem Dasein trennt den anonymen Raum vom Ort unseres Seins. Der deutsche Faschismus hat die, von Heidegger in die Diskussion gebrachte, Enthausung des Menschen durch die Moderne mit den ihnen eigenen hausbackenen und praktischen Mitteln beantwortet. Er verordnete die Fachwerk- und Giebelarchitektur für das Private und den eleganteren Klassizismus für das Repräsentative. Diese Hinwendung zum Mittelalter und der Antike war der Versuch, eine längst verlorene Welt im bloßen Rückgriff auf Klischees wiederherzustellen. Eine Welt, die einst umwölbt und eingebettet war in einem geschichtlich gewachsenen Ganzen. 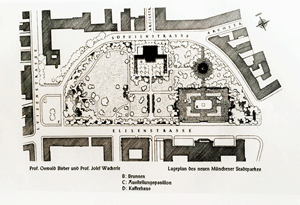 1934_Lageplan eines neuen StadtgartensDer Kunstpavillon im botanischen Garten in München ist, als Teil eines architektonischen Gesamtensembles, ein Manifest gegen die Moderne und ein ambitionierter Versuch, einen Raum als Ort herzustellen.
1934_Lageplan eines neuen StadtgartensDer Kunstpavillon im botanischen Garten in München ist, als Teil eines architektonischen Gesamtensembles, ein Manifest gegen die Moderne und ein ambitionierter Versuch, einen Raum als Ort herzustellen.
Ob dieser Ort nun ein Atelier oder einen Ausstellungsraum beherbergen sollte, ist bis heute nicht geklärt. Angeblich war er als Atelier für den Bildhauer Josef Thorak gedacht. Hitler persönlich soll ihm den Raum zu seinem Geburtstag geschenkt haben. Thorak soll sein neues Atelier wegen der geringen Größe von 200 qm Grundfläche und 11 m Raumhöhe nie genutzt haben. Diese Sage passt ganz gut zu dieser neoklassizistischen architecture parlante. Es gibt gute Gründe, die darauf hindeuten, warum der Pavillon als Bildhaueratelier gebaut wurde. Der offensichtlichste ist die Allegorie der Bildhauerei über dem Haupteingang des Pavillons. Joseph Wackerle hat dieses Emblem als Relief in den Türrahmen der Südtür eingehauen. Er, Paul Ludwig Trost und Oswald Bieber entwarfen 1934 dieses städtebauliche Ensemble aus altem botanischen Garten, Kunstpavillon und Neptunbrunnen, der die alleinige Autorenschaft von Joseph Wackerle trägt.  2012_Neptunbrunnen mit Kunstpavillon Eingang SüdseiteEr ist aus Kirchheimer Muschelkalk gehauen, genauso wie die Reliefs in den Türrahmen. Material, symbolistische Sprache und räumliche Beziehung verweisen Brunnen und Pavillon aufeinander. Sie bilden zusammen einen Kontrapunkt.
2012_Neptunbrunnen mit Kunstpavillon Eingang SüdseiteEr ist aus Kirchheimer Muschelkalk gehauen, genauso wie die Reliefs in den Türrahmen. Material, symbolistische Sprache und räumliche Beziehung verweisen Brunnen und Pavillon aufeinander. Sie bilden zusammen einen Kontrapunkt.
Der freistehende quadratische Bau des Pavillons mit seinen massiven, fensterlosen Außenmauern und den vier monumentalen Eichentüren in den Mittelachsen wirkt wie ein überdimensionaler Sockel in der Gartenlandschaft. Das Licht für den Innenraum kommt durch eine Oberlichtdecke. Diese überspannt den ganzen Kubus. Dem (Mani)Festen der wuchtigen Architektur steht das Flüssige des Brunnens gegenüber. Auch die anderen Eichentüren sind mit Allegorien gekrönt. Neben der Bildhauerei sind die Architektur, die Malerei und die Musik über den Eingängen verewigt. Der Stil der Allegorien, wie auch das Fehlen der Darstellung der Dichtkunst, verweisen auf eine griechisch-antike Kunstauffassung. In diesem Zusammenhang macht es auch Sinn, dass die Allegorie der Malerei nicht als Tafelmalerei, sondern als Vasenmalerei wiedergegeben wird. Die allegorischen Applikationen an der minimalistischen Architektur funktionieren wie eine Etikettierung der Architektur. Hier muss ein aufgeladener Symbolismus aus der antiken Welt die Raumhülle zum gewollten Ort aufladen. In Verbindung mit dem neobarocken Brunnen offenbart sich ein Stilmix, der die Aufgabe hat, die Zeit rückwärts zu drehen. Ludwig Trost war ein Innenarchitekt von Hochseedampfern. Vielleicht wirkt der Pavillon deshalb auch wie ein überdimensionales Möbelstück im Garten. Verschiedene Materialien und Farben wurden miteinander dekorativ kombiniert. Die große gelbe Fassade strukturieren braune Eichenportale, die eingefasst sind in einen breiten Rahmen aus gelb-grauem Muschelkalk. Im weiß gehaltenen Innenraum korrespondiert der rötlich-dunkelgraue Sandstein des Bodens mit den graublauen Fenstern des Oberlichts. Auch heute noch ist der Pavillon lesbares Zeugnis seines Anspruchs auf „ewige Setzung“, sowohl was die symbolische Aufladung, als auch was die Wahl der Materialen betrifft. Der Krieg hat das Gebäude zerstört. Danach wurde es von einer Künstlervereinigung wiederaufgebaut. Dabei wurden drei der monumentalen Eingänge zugemauert, um im Inneren eine durchgehende Wandfläche zu bekommen.  Gunter Demnig, 3 Stolpersteine im Kunstpavillon Die Südtür, mit der Allegorie der Bildhauerei, die auch die Beziehung zum Neptunbrunnen stiftet, dient heute als einziger Eingang. Seit den 80er Jahren steht über diesem Portal in Neonbuchstaben der Satz „Kunst ist kein Luxus“. 2007 wurden im Innenraum 3 Stolpersteine von Gunter Demnig verlegt.
Gunter Demnig, 3 Stolpersteine im Kunstpavillon Die Südtür, mit der Allegorie der Bildhauerei, die auch die Beziehung zum Neptunbrunnen stiftet, dient heute als einziger Eingang. Seit den 80er Jahren steht über diesem Portal in Neonbuchstaben der Satz „Kunst ist kein Luxus“. 2007 wurden im Innenraum 3 Stolpersteine von Gunter Demnig verlegt.
Auf dem Hintergrund dieser kleinen Raumgeschichte ist es verständlich, dass die beiden Künstler Michael Hofstetter und Kay Winkler den Kunstpavillon, trotz seines weißen Innenraums, nicht als neutralen fond, als „white cube“ benutzen, um dort ihre „autonomen“ Kunstwerke auszustellen. Wie aber erspielt man sich einen Raum, der schon von Beginn an ein Spielverderber ist? Denn eines war den beiden mehr als offensichtlich: Gerade weil diese Architektur sich als Ort in eine tausendjährige Ewigkeit einfrieren wollte, blieb er dann letztlich nichts anderes als eine Fassade des faschistischen Zeitgeists.
Verspielen ist eine künstlerische Intervention, die dem aufgeblasenen Kunstwollen dieser Architektur und seiner Wuchtigkeit frei entgegenspielt. Ausgehend von dem ideologisch-geistesgeschichtlichen Hintergrund dieser Architektur, sichtbar an den Außenreliefs von Wackerle, drängt sich die Frage auf, wie die Ideen in das Material kommen. Ein Problem, das so alt ist wie die Bildhauerei selbst. Und das die Moderne dadurch löste, dass sie keine Ideen am Material zuließ. Die scheinbar gelungene Verbindung von Idee und Material, die Wackerle an den Allegorien vollführt, wird in der Intervention von Hofstetter und Winkler zum Hauptspannungsfeld. Dass diese Verbindung eine gesetzte und willkürliche ist, legen die beiden mit ihrem künstlerischen Eingriff offen. Aber zunächst spielen sie auf derselben Ebene weiter und zwingen auf unterschiedliche Weise dem Material Bildideen auf, um diese dann am Material selbst scheitern zu lassen.  Kunstpavillon, Nordeingang, Josef Wackerle, Allegorie der MalereiDas in ihrer Kunst problematisierte Verhältnis von Bild und Material bzw. von Zeichen und Volumen ist explizit in der Allegorie der Malerei an der Nordfassade dargestellt. Denn die Vasenmalerei der Griechen ist keine bloße Dekoration eines Gefäßes, es ist eine – inzwischen wieder aktuelle – Reflektion über das Verhältnis von Phantasie und Substanz oder Zeichen und Realität.
Kunstpavillon, Nordeingang, Josef Wackerle, Allegorie der MalereiDas in ihrer Kunst problematisierte Verhältnis von Bild und Material bzw. von Zeichen und Volumen ist explizit in der Allegorie der Malerei an der Nordfassade dargestellt. Denn die Vasenmalerei der Griechen ist keine bloße Dekoration eines Gefäßes, es ist eine – inzwischen wieder aktuelle – Reflektion über das Verhältnis von Phantasie und Substanz oder Zeichen und Realität.
Die beiden Künstler deklinieren dieses Verhältnis spielerisch bis zum bitteren Ende durch. Bis zu dem Punkt, wo dieses Spiel sein eigenes Kapital verspielt. Nicht irgendwelche falschen Muster werden entlarvt, nichts wird übergestülpt, eher wird dem Raum gegeben, wonach er idiosynkratisch verlangt: Dem gegebenen freien Spiel der Zeichen mit Materialen wird ein weiteres Spiel der Zeichen mit neuen Materialen hinzugefügt. Michael Hofstetter und Kay Winkler setzen im Wortsinne Bei-Spiele. Dabei geht es weniger um die moralische Auseinandersetzung mit der historischen Vergangenheit, sondern um einen Prozess der Verdichtung, Verschiebung, Verdopplung und Parallelisierung, und dabei auch um einen Klärungsprozess im zeitgenössischen Kunstdiskurs selbst.
Mit Mitteln der Verführung und dem Schein der Verfügbarkeit zeigt das Werk Verspielen in seinem inhärenten zeitlichen Verlauf einen Entzug, an dessen Ende sich eine Emanation der Unverfügbarkeit ereignet. Denn so viel sei hier schon gesagt: Das Versprechen der Zeichen scheitert immer am Material – ob zu skulpturalen Symbolen gehauen, in Design geformt oder bloßer Träger von aufgedruckten oder eingravierten Zeichen. Denn in der christlichen Realität gibt es keine Idee ohne einen materiellen Träger. Selbst die Gigabytes von Daten brauchen einen Chip, dem sie materiell anhaften.
Michael Hofstetters und Kay Winklers Spiel mit dem Unmöglichkeitsraum ist über alle konzeptionell luzide Präzision im Umgang mit der Architektur des Kunstpavillons hinweg eine Erweiterung und eine Ort-Reflektion auf vielen sich ergänzenden Ebenen. Der erste Zug kommt von Kay Winkler: Mit einer riesigen, aufgelassenen rostfarbenen Taucherglocke, die auf dem Boden unter dem Oberlicht in der Mitte des Ausstellungsraums liegt, nimmt Kay Winkler nochmals Bezug zum Neptunbrunnen und markiert im neuen Spielfeld den Meeresgrund und den Fluss der Zeit. Der mit Eisenstaub versetzte Gips schaut aus wie Eisen und erzählt so, als Materialsimulacrum, die Geschichte des Werkstoffs Gips als dem Material, aus dem sich alles modellieren und insofern aus jedem Gegenstand ein Imitat herstellen ließ.
Hoch darüber, als bildnerisches Gegengewicht, läßt Michael Hofstetter Ballons aus schwarzem Gummi schweben oder schwimmen, die – wenn wir im Bild der Taucherglocke bleiben – an der Wasseroberfläche dümpeln. Gegen die Glasdecke drückend und eingefügt in das Raster des Oberlichtfensters hält sie ihre Heliumfüllung zunächst dort oben. Unter dem Glasdach hängt ein schwarzer pyramidal zulaufender Block. Paradoxal verdunkelt er den Ausstellungsraum. Und erst im Laufe der Zeit, vom Grund heruntergezogen, sinken die Ballone gemächlich nach unten – und es wird Licht. Ihr Gastgeschenk, das durch sie mit hinabgezogene Tageslicht ist ein Danaer-Gabe, da der Lichtbringer zugleich den Grund bedeckt, ihn erblinden lässt. Ein Wechselspiel zwischen Dunkel und Licht, zwischen Verbergen und Entbergen, zwischen Höhle und Erkenntnis. Analogie und Assoziation: Auch in einem Künstleratelier drängen die Materialisierungen von Träumen, Visionen und Vorstellungsbildern hervor, wollen ans Licht – oder verflüchtigen sich im Prozess der Übersetzung. Das klassische Erkenntnismodell der Erleuchtung gerät ins Schlingern: Hier ist das Kunstwerk beides, Spiegel und Lichtbringer.
 Technische Beschreibung der Montgolfière von 1786Auch die Eroberung des Luftraums ist mit den Ballons assoziiert, der uralte Traum vom Fliegen in die komplizierte Freiheit, in die metaphysische Unendlichkeit. Die Vorstellung, dass solche Versuche eine Herausforderung der Götter, eine frevelhafte Einmischung in die himmlischen Angelegenheiten seien, folgt dem auf dem Fuße. Trotzdem wurde der Traum Realität, und wie Hofstetters Ballone gondelte die Montgolfiere mit ihren Tieren, mit Ente, Huhn und Schaf durch das Meer der Lüfte, trieb wie ein Segelschiff mit dem Wind.
Technische Beschreibung der Montgolfière von 1786Auch die Eroberung des Luftraums ist mit den Ballons assoziiert, der uralte Traum vom Fliegen in die komplizierte Freiheit, in die metaphysische Unendlichkeit. Die Vorstellung, dass solche Versuche eine Herausforderung der Götter, eine frevelhafte Einmischung in die himmlischen Angelegenheiten seien, folgt dem auf dem Fuße. Trotzdem wurde der Traum Realität, und wie Hofstetters Ballone gondelte die Montgolfiere mit ihren Tieren, mit Ente, Huhn und Schaf durch das Meer der Lüfte, trieb wie ein Segelschiff mit dem Wind.
Im Ausstellungsraum sind nun Oben und Unten, Wasser und Luft, Licht und Dunkel Teil und Teilhabe eines unauflöslichen Spiels und Widerspiels. In einem gleichsam osmotischen, spontanen Mischungsvorgang, in einem wechselseitigen Eindringen und Verwandeln schweben unterschiedliche Bildvorstellungen, die Anstoß, Schub und Antrieb sind, hin zu weiteren, weiten Horizonten. Luftfahrt und Tauchgang sind natürlich auch Versuche der Grenzüberschreitung des dem Menschen zugedachten Raums, sind ein Wunschbild der Überwindung leiblicher Beschränkung. Sie legen Zeugnis ab von der Sehnsucht nach dem Anderen, dem Unbekannten, dem Abgrund, der so verführerisch wie bedrohlich wirkt. Die Frage, welche Welt wohl hinter dem Horizont und am Grunde des Meeres liege, ist zugleich eine Entdeckungsreise des Blicks, der sich durch Taucherglocke und Luftgespann mit neuer Aufmerksamkeit und mit anderen methodologischen Apparaturen ins Un- oder Halbbewusste tastet, ins Erinnern der verschütteten, vielgestaltigen Hinterlassenschaften der Vergangenheit.
 Alexander der Große, Taucherglocke, IllustrationDie Taucherglocke und das Luftgespann dienen auch als Instrumente für einen erweiternden, erweiterten Weltverkehr; schon Aristoteles erwähnt diese Erfindung, und Alexander der Große soll sich in abenteuerlicher Weise von einem Greifengespann himmelwärts gebracht haben lassen und gleich darauf mittels einer gläsernen Glocke auf den Meeresgrund: Eroberungsvorstöße in unzugängliche Elementarregionen, Auf- und Niederfahrt im historisch verbrieften Imaginären. In einigen Versionen der fabelhaften Geschichten wird Alexander von seinen Helfern kläglich im Stich gelassen. Alexander behilft sich mit einem ausgesprochen befremdlichen Trick: Er tötet einen eigens mitgenommenen Hund, vor dessen Blut das Salzwasser „bekanntlich“ zurückweicht. (1) Schon ist die Glocke wieder frei.
Alexander der Große, Taucherglocke, IllustrationDie Taucherglocke und das Luftgespann dienen auch als Instrumente für einen erweiternden, erweiterten Weltverkehr; schon Aristoteles erwähnt diese Erfindung, und Alexander der Große soll sich in abenteuerlicher Weise von einem Greifengespann himmelwärts gebracht haben lassen und gleich darauf mittels einer gläsernen Glocke auf den Meeresgrund: Eroberungsvorstöße in unzugängliche Elementarregionen, Auf- und Niederfahrt im historisch verbrieften Imaginären. In einigen Versionen der fabelhaften Geschichten wird Alexander von seinen Helfern kläglich im Stich gelassen. Alexander behilft sich mit einem ausgesprochen befremdlichen Trick: Er tötet einen eigens mitgenommenen Hund, vor dessen Blut das Salzwasser „bekanntlich“ zurückweicht. (1) Schon ist die Glocke wieder frei.
1 Vgl. Alexander Demandt, „Alexander der Große, Leben und Legende“, C.H. Beck Verlag, München 2009, S.311
Mit ihren skulpturalen Bilderfindungen bringen die beiden Künstler Fortschreibung und Neuschöpfung, Vergangenheit und Gegenwart in eine oszillierende Interaktion. Im zweiten Zug dann tritt das uralte, vertrackte Verhältnis zwischen Analyse und Poesie, zwischen Konstruktion und Mimesis hinzu in der von Winkler in schwarzem Wachs gegossenen Porträtbüste seines Mitspielers Hofstetter.  Kay Winkler, M, 2012Sie schwimmt in wagemutiger Verrückung von Verhältnis und Zweck im Wasser der großen, ausgeteerten Taucherglocke. Die Fragilität, der die plastische Wandelbarkeit des Materials Wachs zuspielt, das Changement zwischen Fragment und Totalität, die eigensinnige Lebendigkeit, die dieser Kopf im Licht, im Schatten zugewinnt, sind die Spur eines Energons, erscheinen wie die Archäologie eines Wunsches, etwas ans Licht zu holen: Ein dialektisches Bild eines unzeitgemäßen Gegenstands, aktuelle Praxis und alte Technik fallen in eins – in Analogie zu Welt, Raum und Kopf: „[S]o erscheint die Himmelswölbung mir beinahe als das Inn’re eines ungeheuren Schädels und wir als seine Grillen!” (2)
Kay Winkler, M, 2012Sie schwimmt in wagemutiger Verrückung von Verhältnis und Zweck im Wasser der großen, ausgeteerten Taucherglocke. Die Fragilität, der die plastische Wandelbarkeit des Materials Wachs zuspielt, das Changement zwischen Fragment und Totalität, die eigensinnige Lebendigkeit, die dieser Kopf im Licht, im Schatten zugewinnt, sind die Spur eines Energons, erscheinen wie die Archäologie eines Wunsches, etwas ans Licht zu holen: Ein dialektisches Bild eines unzeitgemäßen Gegenstands, aktuelle Praxis und alte Technik fallen in eins – in Analogie zu Welt, Raum und Kopf: „[S]o erscheint die Himmelswölbung mir beinahe als das Inn’re eines ungeheuren Schädels und wir als seine Grillen!” (2)
2 Christian Dietrich Grabbe, „Marius und Sulla“, In: ders. „Dramatische Dichtungen“, Verlag Hermann, Frankfurt a. M. 1827, S.307
Dieser im Wasser schwimmende Kunst-Künstlerkopf wird kommentiert durch die boötische Vasenzeichnung der Potnia Theron auf den Ballons. Potnia Theron, einst die Herrin der Tiere, wird hier als sich begattende Doppelfigur dargestellt, die von mystischen Tieren und aktuellen Viren ornamental eingefasst ist.  Potnia Theron, antike VasenzeichnungWir ahnen es: diese Tiere sind nicht von derselben Art, wie die, die als erste Passagiere für die Jungfernfahrt der Montgolfiere herhalten mussten. Auf den Ballonen sind es Wesen in übergänglicher Allianz zwischen Tier und Mensch. In der Montgolfiere sind es schon Dinge, Testobjekte die im Falle des Scheiterns dieser Mission verschmerzbar gewesen wären.
Potnia Theron, antike VasenzeichnungWir ahnen es: diese Tiere sind nicht von derselben Art, wie die, die als erste Passagiere für die Jungfernfahrt der Montgolfiere herhalten mussten. Auf den Ballonen sind es Wesen in übergänglicher Allianz zwischen Tier und Mensch. In der Montgolfiere sind es schon Dinge, Testobjekte die im Falle des Scheiterns dieser Mission verschmerzbar gewesen wären.
Die zentrale Figur dieser Ausstellung ist die Kugel. Diese Elementarform bildet das Scharnier, sowohl zwischen den beiden Künstlern, als auch zwischen der Kunstproduktion und ihrer Rezeption. Die Kugel als Taucherglocke, Luftballon und Kopf gibt der Ausstellung Form, Gestalt und Distanz. Gleichzeitig bietet sie als Projektionsfläche die Möglichkeit für ein komplexes Bildergeflecht, das durch die Interaktion der drei Kugelformen ins Unendliche fortwächst. Gerade die Kugelform ist ein zentrales Symbol der abendländischen Kultur und weist weit zurück: In der Genesis ist die Menschenschöpfung zunächst Gefäßherstellung, ein modellierter Hohlraum, der erst in einem Inspirationsakt zum lebendigen Wesen wird.  Varnese Atlas, 2JhDie Schöpfung ist hier beschrieben als kommunikative Allianz im pneumatischen Akt – und auch im Kunstwerk geschieht je und je die Animation der toten Materie, die im Prozess der Verkörperung und der Betrachtung vital und gebannt wird: „Du lebst und thust mir nichts“ (3) – die Notiz von Aby Warburg umgreift nicht nur die Rettung des bewegten Anderen durch die besonnene Gestaltung und das Spannungsverhältnis zwischen lebendiger Erfahrung und rationaler Distanzierung im Kunstwerk, sondern auch die Entstehung von Strukturen von Sinn. Und durchaus könnte man das Pingpong der beiden Künstler ebenso als wundersamen Pakt begreifen. Aus jeder Seh-Bewegung zwischen den einzelnen Elementen mag eine neue Information herausspringen, immer wieder neu eröffnen sich Relationen mit Knotenpunkten, Anschlüssen, Verbindungslinien – und wie in einem Netz verfangen sich zugleich bekannte Bilder mit Heterogenem und gänzlich Unerwartetem. Zeichen, die den Formgrund der Bilderfindungen gleichsam als submarine Geschichte erzählen.
Varnese Atlas, 2JhDie Schöpfung ist hier beschrieben als kommunikative Allianz im pneumatischen Akt – und auch im Kunstwerk geschieht je und je die Animation der toten Materie, die im Prozess der Verkörperung und der Betrachtung vital und gebannt wird: „Du lebst und thust mir nichts“ (3) – die Notiz von Aby Warburg umgreift nicht nur die Rettung des bewegten Anderen durch die besonnene Gestaltung und das Spannungsverhältnis zwischen lebendiger Erfahrung und rationaler Distanzierung im Kunstwerk, sondern auch die Entstehung von Strukturen von Sinn. Und durchaus könnte man das Pingpong der beiden Künstler ebenso als wundersamen Pakt begreifen. Aus jeder Seh-Bewegung zwischen den einzelnen Elementen mag eine neue Information herausspringen, immer wieder neu eröffnen sich Relationen mit Knotenpunkten, Anschlüssen, Verbindungslinien – und wie in einem Netz verfangen sich zugleich bekannte Bilder mit Heterogenem und gänzlich Unerwartetem. Zeichen, die den Formgrund der Bilderfindungen gleichsam als submarine Geschichte erzählen.
3 So das Motto von Warburgs Fragmenten zu einer Psychologie der Kunst,
zit. nach: Ernst H. Gombrich: „Aby Warburg: eine intellektuelle Biographie“, Philo Fine Arts, S.98.
„... Der »symbolisch verknüpfende Mensch» bildet das Bindeglied zwischen dem totemistischen »Greif-Menschen» und dem abstrakt-logischen »Denkmenschen». Bilder und Symbole sind, nach Warburg, gestaltete Affekte. Sie sind Speicher der phobischen Energie, die in ihnen weiterlebt. Zugleich aber schaffen sie eine Distanz zu ihrer Ursache. Die Angst ist objektiviert und geformt, die Angstursache benannt und somit auch wieder gebannt. Die Angst ist im Bild oder Symbol zwar präsent, im Unterschied zum Totem oder zum Fetisch setzt sie der Betrachter aber nicht mehr mit dem Objekt gleich. Das meint Warburg, wenn er sagt »Du lebst und thust mir nichts»...“
aus: „1. ldea non vincit. Warburg und die Krise der liberalen Moderne“
in: Fernando Esposito: „Mythische Moderne: Aviatik, Faschismus und die Sehnsucht nach Ordnung in Italien und Deutschland“, Oldenbourg Verlag, München, 2011, S.81.
Michael Hofstetter und Kay Winkler reflektieren in irritierender Gleichzeitigkeit unterschiedliche Denkmodelle. Schon die beiden Titel weisen den Weg. Hofstetter arbeitet mit indexikalischen Verweisen, wie wir sie von der Fotografie her kennen. Sein Titel avec et sans gaz legt eine Spur zu Duchamps Werk Étant donnés, in dessen Erweiterung auch steht, was in diesem Werk gegeben sei: 1° la chute d’eau; 2° le gaz d’éclairage ... Winklers Titel "Im Grunde grundlos" verweist in poetischer Weise auf etwas Grundsätzliches: auf den nie begründbaren Anfang. Dass jeder Anfang eine Setzung aus dem Nichts ist. Eine Setzung, die erst im Gesetztsein aufgehoben ist im doppelten Sinn des Wortes.(4) Winkler fragt nach dem Horizont künstlerischen Tuns und danach, inwiefern das Werk selbst seinen Horizont schafft. Denn jedes Werk ist gleichzeitig Fassung und Gefasstes.
4“Umgekehrt waltet aus dem Wesen des Grundes das Sein als Sein. Grund und Sein («sind») das Selbe, nicht das Gleiche, was schon die Verschiedenheit der Namen «Sein» und «Grund» anzeigt. Sein «ist» im Wesen: Grund. Darum kann Sein nie erst noch einen Grund haben, der es begründen sollte. Demgemäß bleibt der Grund vom Sein weg. Der Grund bleibt ab vom Sein. Im Sinne solchen Ab-bleibens des Grundes vom Sein «ist» das Sein der Ab-Grund. Insofern das Sein als solches in sich grün-dend ist, bleibt es selbst grundlos. Das «Sein» fällt nicht in den Machtbereich des Satzes vom Grund, sondern nur das Seiende.“
Martin Heidegger „Der Satz vom Grund“, Günther Neske, Tübingen 1957, S.94 ff
Souverän spielen die beiden mit diesen verschiedenen Repräsentationsebenen und verschleifen sich gegenseitig in produktiver Weise. Manchmal, so hat man den Eindruck, geht man als Kunstgeschichtler den beiden Künstlern auf den Leim – beim Nachverfolgen der Pathosformeln und der indexikalischen Verweise, die, sich gegenseitig steigernd, ein Reservoir von Bewegungen und Emotionen bilden, die gebannt durch die Zeit ziehen: Fossilien in Bewegung, die uns bewegen, die unsere Wahrnehmung verwandeln können. Bei allen Assoziationsketten, die sich auftun, steht im Zentrum dieser Arbeit die Bewegung selbst. Denn die inhärente Zeitlichkeit dieser Intervention macht letztlich aus dem Raum einen Ort und aus dem Spiel eine Skulptur. Denn „nur auf dem Grunde der ekstatisch-horizontalen Zeitlichkeit ist der Einbruch des Daseins in den Raum möglich“.(5)
5 Martin Heidegger, „Sein und Zeit“, Max Niemayer Verlag, Tübingen 1986, S.369
In aller Reduktion schaffen die beiden Künstler eine turbulente Dichte, in der jede Einzelheit vieldeutig wird. Dabei entsteht die Form, die Formativität des gesamten Ensembles aus dem Prozess von Annäherung und Entfernung, von Drehungen und Spiralen, die jedem Denken eigentümlich sind. Im Blick auf den wie abgeschlagenen Kopf liegt die Erinnerung an Alexanders Hunde-Blut-Opfer. Die Potnia Theron wiederum ist eine Gottheit der Antike, die als Herrin der wilden Tiere, aber auch von Fabelwesen und Zwittergestalten gilt. In ihrer Vorstellung stehen Opfer und Täter in einer symbiotischen Beziehung. Sie ist Jägerin und Beschützerin zugleich. In Wandlungen, Um- und Neuformulierungen wird sie bei Homer zur Artemis, die ihren Zwillingsbruder Apoll zum Kampf gegen Poseidon treibt, gegen den Gott des Meeres, in dessen Element wiederum die Taucherglocke spielt:
Aber da schalt ihn bitter die Schwester, die Herrin des Wildes,
Artemis, die die Fluten durcheilt, und schmähend begann sie:
„Wirklich, o trefflicher Schütze, du fliehst, und läßt dem Poseidon
Völlig den Sieg und läßt ihm leichterrungene Ehre?“ (6)
6 Homer, „Ilias“, 21. Gesang
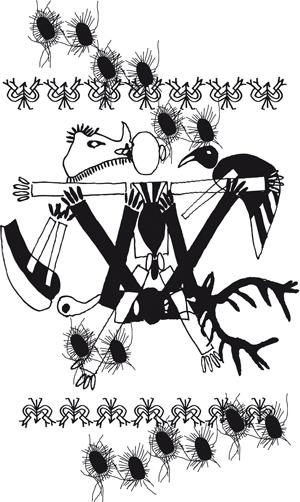 Michael Hofstetter, Entwurfszeichnung für den Siebdruck auf die Luftballone, 2011In den antiken Bildvorstellungen der Potnia Theron schwingt auch der Dualismus des Männlichen und des Weiblichen, die Vorstellung von Fruchtbarkeit und Fortpflanzung und damit eine komplexe Beziehung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit.
Michael Hofstetter, Entwurfszeichnung für den Siebdruck auf die Luftballone, 2011In den antiken Bildvorstellungen der Potnia Theron schwingt auch der Dualismus des Männlichen und des Weiblichen, die Vorstellung von Fruchtbarkeit und Fortpflanzung und damit eine komplexe Beziehung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit.
In Hofstetters Zeichnung der Herrin der Tiere wird in der Selbstbegattung der besagte Dualismus für einen Augenblick im Sich-Selbst-Genug-Sein aufgehoben. Ihr Bild mag aber auch durch die sehende Verknüpfung mit dem abgeschlagenen Kopf ein mythologisches up-date erfahren, wenn wir an die Legende der Salome denken, die ihrerseits ein komplexes und ambivalentes Gewebe ist. In vielen Versionen entsteht ihre erotische Dämonie, ihre tödliche Absicht erst durch die Zurückweisung Jochanaans; fortan siedelt sie im Zwischenreich zwischen Frau und Raubtier. Doch Hofstetters Zeichnung ist in der Rückwendung auf Vergangenes und durch sie hindurch kein historisches Genrebild, sondern Stilisierung und Abstrahierung, eine Überschreitung der Geschichte in die Gegenwart hinein, die auf unauflösbare Verstrickungen zwischen den Gegensätzen, die unser Leben ausmachen, verweist.
Im Wechselspiel von ferner Nähe und naher Ferne, von verschiedenen Blickebenen, von Zeiten und Räumen, in der vielschichtigen, in der offenkundigen wie in der subkutanen Verflechtung der Bilder, ist immer auch ein Doppeltes präsent, die zweifache Ordnung des Kunstwerks: Die skulpturalen Elemente der Ausstellung sind und bestehen für sich, sind selbstverständliches Objekt, zugleich aber sind sie Teil eines größeren Zusammenhangs, der allerdings erst im Anschauen und Zusammenbringen der Ding- und Denkfragmente entsteht. In diesem Raumbild unternehmen die beiden Künstler eine Reise in die Raum-Zeit, in die Geschichte und das Gedächtnis der Welten. In ihrer künstlerischen Reflexion spannen sie „die uns mit der Welt verknüpfenden Fäden auf, um sie erscheinen zu lassen.“ (7)
7 Maurice Merleau-Ponty, „Phänomenologie der Wahrnehmung“, De Gruyter Verlag, Berlin 1966, S. 10
Bilder sind mobil und mobilisierend. Wie die Metaphorai, die kommunalen Verkehrsmittel Athens, durchqueren und organisieren sie Orte (8) und eben darin besteht ihre raumbildende Praktik. Bilder und Bildvorstellungen durchwandern auch die Geschichte ihrer Produzenten, sie kommen von weit her, sie überschreiten kulturelle Räume, überkreuzen die Grenzen von Natur und Kultur, von Anthropologie und Geschichte. Sie durchqueren die Geschichte der Medien, in denen sie jeweils aktualisiert in neuem Gewand erscheinen. Im Raum als Ort lesen wir die Zeit und alles Sein ist Hindurchgegangensein. Der Raum und das Gehirn sind „ein Palimpsest ... Unzählige Schichten von Vorstellungen, Bildern, Gefühlen haben sich nacheinander auf dein Gehirn gelegt, so sanft wie Licht. Jede dieser Schichten schien die frühere einzuhüllen. Aber keine ist in Wirklichkeit zugrunde gegangen.“ (9)
8 Siehe dazu: Michel de Certeau, „Kunst des Handelns“, Merve Verlag Berlin 1988, S. 215
9 Charles Baudelaire: „Le palimpseste“, 1860;
„Qu‘ est-ce que le cerveau humain, sinon un palimpseste; immense et naturel? Mon cerveau est un palimpseste et le vôtre aussi, lecteur. Des couches innombrables d‘idées, d‘images, de sentiments sont tombées successivement sur votre cerveau, aussi doucement que la lumière. Il a semblé que chacune a enseveli la précédente. Mais aucune en réalité n‘a péri.“
zitiert aus: Harald Weinrich: „Wie zivilisiert ist der Teufel? Kurze Besuche bei Gut und Böse“, Verlag C.H. Beck, München 2007, S.30
Verspielen ist das Aufschäumen von Zeichenwelten zu Weltzeichen – auch durch ihre geschichtlichen Ablagerungen hindurch. Ihre Stattgabe entnimmt dieses Spiel den eingemeißelten Allegorien am Ort des Geschehens selbst. Ihr Scheitern geschieht durch den – dem Versuchsaufbau geschuldeten – zeitlichen Verlauf. Den Ballons entweicht das in sie hineingepumpte Helium. Ihnen geht sprichwörtlich die Luft aus. Starr liegen sie am Ende der Ausstellung als schwarze Gummilappen auf dem Boden der Realität. Erst eine erneute pneumatische Einhauchung, eine neue Begeisterung, eine neue imaginäre Aufladung würde ihnen wieder Form und Flug und damit die Möglichkeit zu Bewegung und Spiel zurückgeben.
In der Taucherglocke ist das Wasser schmutzig und ölig geworden und größtenteils verdunstet, der Kopf – mehr und mehr seines künstlichen Elementes beraubt – liegt irgendwann wie Strandgut am Boden der Glocke.
Dieses Nachbild, dieser postapokalyptische Zustand, ist keine pathetische Setzung, sondern das aleatorische Ergebnis eines entropischen Verlaufes, der sich bewusst kontrastierend dem
faschistischen Ensemble der Dauer entgegengestellt. Ein Verlauf, den alles Material nimmt – und die durch dieses Material transportierten Zeichen. Dabei sprang das Präfix „Ver“ auf das Spiel. Ein Spiel, das das gegebene Spiel zu Ende spielte – bis die Spielregeln offenlagen.
Dorothée Bauerle-Willert
Shiva Lachen













